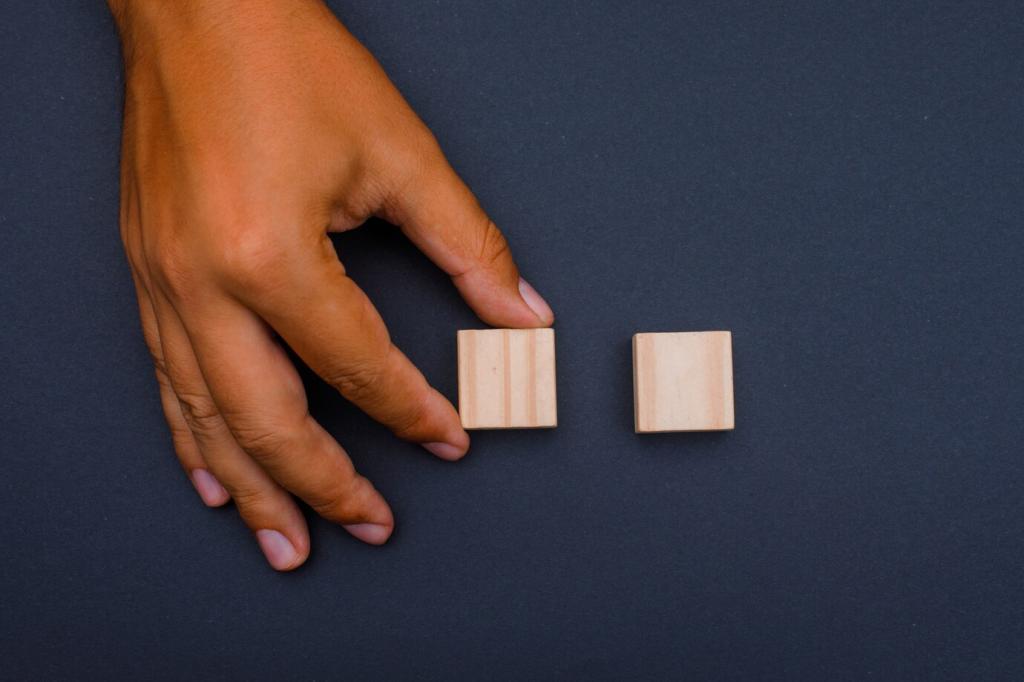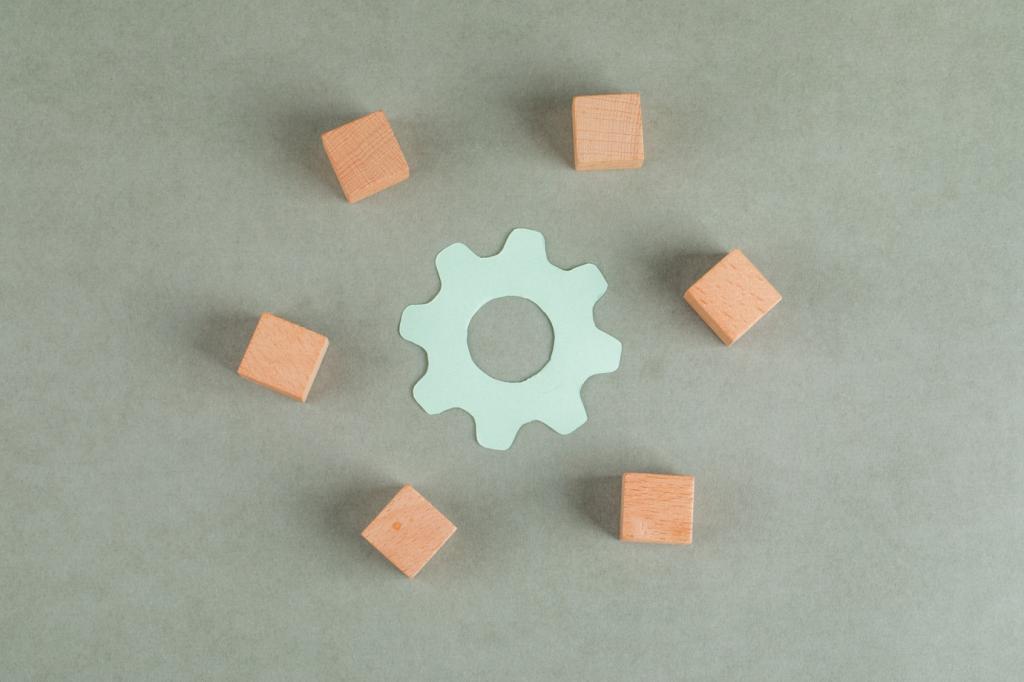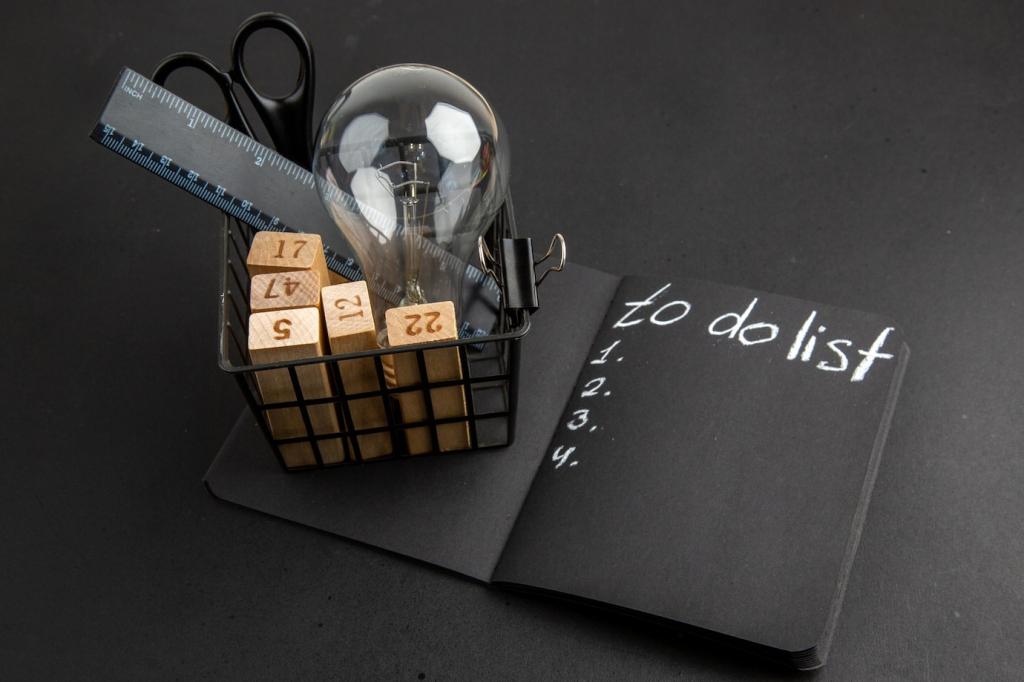Teamrollen und Kultur: Citizen Developer trifft Profi
Schulen Sie Citizen Developer in Datenpflege, Sicherheit und UX-Grundlagen. Entwicklerinnen fokussieren auf Standards, Integrationen und Qualität. So entstehen belastbare Lösungen, die Fachlichkeit und Technik elegant verbinden.
Teamrollen und Kultur: Citizen Developer trifft Profi
Auch in visuellen Tools wirken Guidelines Wunder: Benennungsregeln, Komponentenbibliotheken und Review-Checklisten. Teams berichten, dass saubere Muster spätere Wartungskosten spürbar senken und Onboarding erleichtern.